Lernpräferenztest Prof. Dr. Franz Josef Röll, Dr. Robert Löw
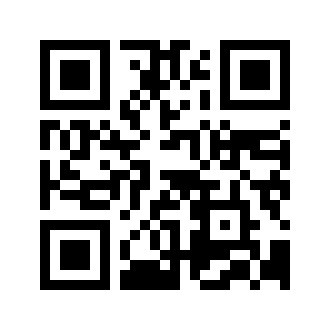
Wissenschaft – Konstrukteur (P-E)
In dieser Rubrik werden Kontexte zu fachwissenschaftlichen Diskursen hergestellt. Hinweise sollen gegeben werden auf Forschungstraditionen,
deren Ergebnisse nachvollziehbar machen, warum dieser Lernpräferenztyp durch pragmatisch-experimentelle Anregungen Impulse zum Lernen bekommt.
Die philosophische Strömung des
Pragmatismus ist kompatibel zum Selbstverständnis des pragmatisch-experimentellen Lernpräferenztyps.
Bei dieser Denkrichtung steht die lebenspraktische Bedeutung des Nachdenkens und Reflektierens im Zentrum der Überlegungen.
Gefragt wird nach dem Nutzen dem Bewirken von unterschiedliche Handlungen, Ideen und Wertungen.
Beim
Empirismus handelt es sich um eine Erkenntnistheorie, bei der alle Erkenntnisse aus der Beobachtung, dem Experiment,
aus der Sinneserfahrung ableitet sind und von keinerlei Vorwissen ausgegangen wird. Der Empirismus steht damit im Gegensatz zum
Rationalismus,
der die Vernunft als wesentlich für den Erkenntnisprozess hervorhebt.
Für den
Behaviorismus werden nur Aussagen als wissenschaftlich anerkannt, wenn ihnen ein beobachtbares Verhalten zu Grunde liegt.
Dieser Wissenschaftsrichtung geht es um eine möglichst objektive Betrachtungsweise von beobachtbaren Verhalten von Lebewesen.
Bei der
sozial-kognitiven Lerntheorie handelt es sich um den Versuch eines einheitlichen theoretischen Bezugsrahmens
für menschliches Denken und Verhalten. Es handelt sich um eine der einflussreichsten und meist zitierten Theorien über das Lernen.
Pragmatismus
Der Begriff pragmatisch wird im allgemeinen Sprachgebrauch meist im Sinn von »praktisch« oder »nützlich« verwendet.
Dies deckt sich auch mit der historischen Bedeutung des Begriffs. Pragmatisch hatte in Griechenland die Bedeutung: nützlich, handelnd, praktisch.
Der Pragmatismus beurteilt das Denken vom Standpunkt der Brauchbarkeit. Im allgemeinen Sprachgebrauch wird unter Pragmatismus
eine zielorientierte Strategie und Handlungsweise verstanden. Pragmatisches Handeln bedeutet, sich sachbezogen und konzentriert
auf das praktische Handeln zu konzentrieren.
Handeln wird aus Sicht des Pragmatismus als Wesensmerkmal des Menschen angesehen. Jegliche Vorstellungen, Begriffe,
Anschauungen und Urteile sollten sich nach der Ansicht der Pragmatiker als Regeln für das Tätigsein und das Verhalten erweisen.
Skeptizismus
ist eine ihrer Grundhaltungen. Es wird bezweifelt, ob es möglich ist, die Welt so abzubilden, dass Sie identisch ist mit der Realität.
Die bisherige Erkenntnis wird nur als Metapher angesehen. Alle Erkenntnisse sind damit keine Wahrheitsaussagen über die objektive Realität,
sondern nur Nutzanwendungen gefolgert aus praktischen Erfahrungen.
Theorien werden bezogen auf ihre praktische Anwendbarkeit bewertet. Auf Vernunft bezogenes Handeln wird rein theoretischen Überlegungen vorgezogen.
Die Gültigkeit von Theorien wird am Erfolg gemessen. Vermutet wird, dass die Theorie in der Sache selbst steckt, da Theorien das Ergebnis von
Überlegungen darüber seien, wie etwas zusammenhängen könnte. Aus der Sache selbst sollen durch immer neuere und verbesserte Versuche diese Erkenntnisse herausgeholt werden.
Das Kriterium der Nützlichkeit und des Erfolges tritt an die Stelle der Wahrheit. Wahrheit sei nichts anderes als Nützlichkeit für das Leben.
Pragmatiker suchen nicht nach wahren Aussagen, sondern nach dem Nützlichkeitswert einer Vorstellung.
In der praktischen Bewährung (in der Logik, im Labor, in einer Institution, etc.) erweist sich der jeweilige Nutzen einer Aussage,
These, Position oder Vermutung.
William James, ein wichtiger Vertreter dieser Auffassung, sagt dazu : »Wahr ist das,
was sich durch seine praktischen Konsequenzen bewährt.«
»Eine Vorstellung ist wahr, solange es für unser Leben nützlich ist, sie zu glauben.«
Ein wahrer Satz für Pragmatisten ist ein Satz, den man einfach bekräftigt. Allerdings muss dieser Satz kompatibel sein mit den
Auffassungen der Teilnehmer einer Gemeinschaft. Für den Menschen verbindliche und allgemeine Normen werden nicht anerkannt.
Moral wird als Vorurteil abgelehnt und gilt nicht als Kriterium des Handelns für den Pragmatisten. Überprüft wird jede Tätigkeit daraufhin,
ob sie erfolgreich ist bezogen auf die sich ändernden und spezifischen Interessen.
Wichtige Vertreter des Pragmatismus sind :
Die Gefahr bei diesem Ansatz besteht darin, dass jegliches Handeln gerechtfertigt und somit der
Technokratismus gefördert wird.
Dinge werden auf ihre technische und organisatorische Durchführbarkeit reflektiert, ohne den gesellschaftlichen Nutzen
(Bedürfnisse) zu berücksichtigen. Eine weitere Gefahr besteht im
Instrumentalismus.
Weitere Informationen finden Sie im Internet :
Technokratismus
Von Technokratie (griechisch:

- Herrschaft durch / der Technik) wird gesprochen,
wenn nicht die Bedürfnisse der Betroffenen über Planungen und Handlungsabläufe bestimmen, sondern allein die technischen Möglichkeiten.
Die theoretischen Konzepte der Technokratie werden als Technokratismus bezeichnet. Die Legitimation von Entscheidungen wird nicht von Normen,
Bedürfnissen und Überzeugungen abgeleitet, sondern von technologischen »Sachzwängen«.
Instrumentalismus
Der Instrumentalismus (lat.: instrumentum, Hilfsmittel, Werkzeug) ist eine spezielle Ausprägung des Pragmatismus,
dessen Ursprünge auf
John Dewey zurückgehen.
Erkenntnistheoretische und wissenschaftsphilosophische Auffassungen werden als Instrumentalismus bezeichnet, wenn die Wissenschaften
nur als Werkzeug gesehen werden, um zu einer verbesserten und systematischeren Handlungsmöglichkeit zu gelangen.
-
Es wird von einem werkzeughaften Charakter des Erkennens in allen Bereichen des Denkens (z.B. Logik, Ethik, Metaphysik, Religion)
zur praktischen Beherrschung von Natur und Menschen ausgegangen. Unterschieden wird nur nach ihrer jeweiligen Brauchbarkeit.
Die Begriffsbildung und alles menschliche Denken werden als eine Anpassung an die Realität angesehen.
Für den Instrumentalismus sind wissenschaftliche Parameter (z.B. Vorstellung von Elektronen) keine Teile der Realität,
sondern nützliche Konstrukte, um die Erfahrungen auf eine zweckmäßige Weise zu ordnen.
Empirismus
Der Empirismus (griech.:

, lat.: experientia - die Erfahrung) behauptet, dass alles Wissen und unsere Erkenntnisse über die Wirklichkeit aus der Sinneserfahrung stammt.
Eine empirische Erkenntnis ist nur da zu finden, wo Erfahrung (und Induktion aus Erfahrungen) gewährleistet ist. Grundsatz
des Empirismus ist die Aussage: »Nichts ist im Verstand, das nicht vorher in den Sinnen war.« Die Sinneserfahrung gilt somit
als die Quelle des unmittelbaren Wissens. Jede »Wahrheit«, die unabhängig von der Erfahrung begründet wurde, wird als analytische Erkenntnis gewertet.
Die Existenz von synthetisch gewonnenen apriorischen Urteilen wird ausgeschlossen.
Empirismus bedeutet im logischen Sinne die Wertung der Erfahrung als einzige Quelle allen Erkennens. In diesem Sinne ist jeder Empirist,
der Begriffe (Erkenntnisse) auf seine Erfahrung zurückführt, Angeborenes verneint und Apriorisches ausschließt, der aber davon überzeugt ist,
dass alle Begriffe Abstraktionen von realen Vorkommnissen und konkreten Erlebnissen sind.
Der klassische Empirismus geht davon aus, dass jegliche Erfahrung nur in Form von persönlichen Erlebnissen gemacht werden kann.
Die Frage stellt sich nunmehr, wie es auf Grundlage rein subjektiver Erkenntnisse möglich sein kann, zu objektiven Erkenntnissen zu gelangen.
Dieses Problem erscheint unlösbar. Konsequenterweise führt der Empirismus (in seiner konsequenten Gestalt) zum
Skeptizismus.
John LOCKE unterscheidet zwei Arten von Empirismus:
-
Die Empfindung gibt Hinweise, dass unsere Sinne mit bestimmten Gegenständen in Berührung getreten sind und unserem
Geist verschiedene Wahrnehmungen zugänglich gemacht wurden (gelb, weiß, heiß, kalt, weich, hart, bitter, süß).
-
Die Reflexion nimmt die Handlungen des eigenen Geistes, der sich mit den Empfindungen auseinander setzt, in uns wahr.
Mittels der Reflexion wird unser Geist mit Ideen ausgestattet (wahrnehmen, denken, zweifeln, glauben, schließen, erkennen, wollen).
Der Empirismus geht davon aus, dass der Geist des Menschen von Geburt an ein unbeschriebenes Blatt
(»tabula rasa« - unbeschriebene Wachstafel) ohne Erfahrung und eigene Ideen ist.
Seine gesamte Erkenntnis besteht somit aus Erfahrung. In der Bewusstseinsphilosophie hat der Empirismus den
Behaviorismus begründet.
In der Wissenschaftsphilosophie wird der
Szientismus
als Form des Empirismus betrachtet.
In den Sozialwissenschaften steht der Begriff »Empirismus« für die empirische Forschung, die keinen Bezug zur Theorie hat
und im Wesentlichen die Beschreibung von Alltagswissen betreibt.
Behaviorismus
Dem so genannten Objektivismus ist erkenntnisphilosophisch die grundlegende Position des Behaviorismus zuzuordnen.
Danach existiert außerhalb des erkennenden Subjekts eine reale, »objektive«, d. h. für alle gleichermaßen erfahrbare Welt.
Angestrebt wird eine möglichst objektive Betrachtungsweise der beobachtbaren, offenen Reaktionen von Menschen.
Das sichtbare und erfassbare Verhalten von Menschen bzw. Lebewesen wird mit experimentellen Methoden untersucht.
Das Verhalten eines Individuums lässt sich dieser Theorie zufolge durch äußere Hinweisreize und Verstärkungen steuern.
Die Konsequenzen auf gezeigtes Verhalten sind bei dieser Theorie entscheidend, nicht die inneren Vorgänge einer Person.
Innere Prozesse werden als Black-Box-Inhalte angesehen. Der Behaviorismus geht von der Annahme aus, dass Verhalten,
das bekräftigt wird, in Zukunft häufiger gezeigt wird. Nicht jedes Lob gilt jedoch als Bekräftigung, da der Lernende
die positive Einschätzung selbst vornehmen muss. Mit Experimenten wurde belegt, dass es durch negative Konsequenzen,
d.h. Bestrafung, zur Reduktion eines zuvor gelernten Verhaltens kommen kann. Allerdings konnte keine Nachhaltigkeit
dieser Lernerfahrung nachgewiesen werden. Da Strafen nicht dazu beitragen, Lernaktivitäten systematisch anzuregen,
ist diese Strategie langfristig nicht erfolgreich. Bei der dritten Annahme wird beabsichtigt, durch Ignorieren das Verhalten zu löschen.
Wenn keine Reaktion der Umwelt erfolgt, wird davon ausgegangen, dass das Verhalten nicht aufrechterhalten wird.
Die Rückmeldung muss unmittelbar auf das Verhalten folgen, damit der Zusammenhang vom Lernenden erkannt wird.
Folgt die Reaktion zu spät, sind die Bestärkungen und Bestrafungen unwirksam. Verhalten kann demgemäß nur aufgebaut werden,
wenn möglichst unmittelbar positive Konsequenzen erfolgen. Der Lernende (mit seinem Verhalten) wird an ein von außen gesetztes Ziel herangeführt.
Die Bemühungen des Lernens richten sich darauf, unterschiedliche Varianten der Verstärkung zu konzipieren und zu identifizieren.
Diese Theorie bietet keine Aufklärung über Lernen, sondern lediglich Orientierung für Lehraktivitäten.
-
Klassisches Konditionieren
Konditionierung ist eine Lerntheorie neben der Assoziationsbildung, Imitation und der Einsicht.
Allgemein bedeutet Konditionierung, eine Reiz-Reaktionsverbindung zu erlernen.
Die klassische Konditionierung ist eine behavioristische Vorstellung des Lernens.
-
Nachdem die Futtergabe an Labor-Hunde immer demselben Ablauf folgte, beobachtete
Iwan Petrowitsch PAWLOW eher zufällig, dass der Speichelfluss bereits einsetzte, bevor sie das Futter selber sehen konnten.
Der Speichelfluss der Hunde ließ sich schließlich damit erklären, dass der Glockenton, der ursprünglich ein neutraler Stimulus (NS) war
und daher zu keiner spezifischen Reaktion führte, zu einem konditionierten Stimulus (CS) geworden war.
Die Hunde hatten gelernt, dass der Glockenton die Futtergabe ankündigt. Dieser hat dann die Bedeutung eines Reizes, der eine konditionierte
Reaktion auslöst und ist daher ein konditionierter Stimulus.
Auf PAWLOWS Vorarbeit aufbauend versuchte
John B. WATSON
die Erkenntnisse auf den Menschen zu übertragen. Der amerikanische Psychologe ging davon aus, dass jedes Verhalten des Menschen konditionierbar sei.
Zur Bestätigung dieser Hypothese ließ er ein Kind (Little Albert Experiment) in einer Variation mit einer Ratte spielen.
Anfänglich zeigte es keine ängstlichen Reaktionen. Nachdem das Kind bei jedem Spiel durch das Geräusch eines Hammers, der auf eine Eisenstange schlug,
erschrocken wurde, zeigte es Angstreaktionen gegenüber der Ratte. Auch hier funktionierte somit das Prinzip, dass ein anfänglich neutraler Stimulus (das Tier),
der wiederholt in Verbindung mit einem unkonditionierten Stimulus (der Hammerschlag) gebracht wird an eine konditionierte Reaktion (Angst des Kindes)
gekoppelt werden kann. Die Ratte wird durch die Wiederholung zu einem konditionierten Stimulus (Angstauslöser), da ein unangenehmen Reiz mit dem Tier assoziiert wird.
-
Operantes Konditionieren
Operantes Konditionieren beschreibt den Lerneffekt, der durch die Reaktion der Umwelt auf ein bestimmtes Verhalten gesteuert wird.
Zeigt sich eine positive Reaktion als Folge einer Handlung, wird sie wiederholt. Im Gegensatz dazu wird das Verhalten nicht mehr oder weniger gezeigt,
wenn sich anschließend eine negative Folge ergibt.
-
Burrhus Frederic SKINNER führte dazu Experimente mit Ratten und Tauben durch.
Seine Versuche baute er auf Vorarbeiten von
Edward Lee THORNDICKE
auf, erweiterte seine Untersuchungen jedoch um die Betrachtung verschiedener Arten der Verstärkung als Konsequenz für ein Verhalten.
In einem Experiment, wurden Ratten in einem Käfig in drei verschiedenen Situationen untersucht. Die erste Ratte erhielt über einen Hebel im Käfig Futter,
die zweite Ratte löste durch einen Hebel einen Stromschlag aus, bei der Dritten wurde der Strom beim Ziehen des Hebels abgestellt.
Es zeigte sich, dass die Ratten nach einiger Zeit belohntes Verhalten wiederholten. Daher wurde der futtergebende Hebel und der, über den der Strom
auf dem Bodengitter abgeschaltet wurde, zunehmend häufiger betätigt. Sie vermieden hingegen das Verhalten, wenn negative Konsequenzen, wie der Stromschlag,
die Folge waren. Von diesen Beobachtungen leitet B. F. SKINNE R den Effekt ‘Lernen am Erfolg’, der auch ‘Lernen durch Verstärkung’ genannt wird, ab.
Seine Beobachtungen kennen wir aus dem Alltag. So werden Noten als positive oder negative Konsequenz empfunden.
Ist jedoch keine entsprechende Konsequenz die Folge, wird auch nicht das gewünschte Verhalten gezeigt.
Nach diesem Konzept ist es wesentlich, ob ein Schüler, der etwas in einem Laden klaut, von seinen Freunden bewundert wird oder eine Strafe erhält.
Sowohl das klassische als auch das operante Konditionieren werden dafür kritisiert, dass sie von einem mechanistischen Menschenbild ausgehen.
Der Mensch wird als passives, berechenbares Wesen angesehen. Individualität wird übergangen und es werden nur die Ergebnisse,
nicht die inneren Ursachen, betrachtet (Black Box). Intrinsische Motivation beispielsweise kann von diesen behavioristischen Modellen nicht erklärt werden.
Die Theorien des operanten und klassischen Konditionierens setzen ein Zeigen und das Zusammenführen von Reflexen und Reaktionen voraus.
Mit BANDURAS sozialkognitiver Lerntheorie wurde die inneren Vorgänge Teil des Nachdenkens über das Lernen.
Sozial-kognitive Lerntheorie (Modell-Lernen)
Als Referenztheorie des sozial-kognitiven Ansatzes (Modell-Lernen) gilt die Lerntheorie von
Albert BANDURA (1976). Aus der Beobachtung und der Imitation sozialer Verhaltensmodelle erwirbt der Mensch nach dem Verständnis
dieses Ansatzes durch Modelllernen eine Vielzahl von Verhaltensmöglichkeiten (Verhalten, Gedanken und Gefühle).
Der Lernende wird »Beobachter« genannt, der oder das Beobachtete »Leitbild« oder »Modell«.
Durch das Beobachten eines Modells können demgemäß neue Verhaltensweisen erlernt (modellierender Effekt) werden,
vorhandene Hemmschwellen können steigen oder sinken (enthemmender/hemmender Effekt) und bestehendes Verhalten kann ausgelöst werden (auslösender Effekt).
Das beobachtete Verhalten wird dabei in allgemeinen Schemata oder kognitiven Strategien abstrahiert und somit nicht einfach kopiert.
Bei diesem Ansatz werden einzelne Merkmale der behavioristischen Lerntheorie in einen umfassenden Bezugsrahmen gestellt.
Das Prinzip der Verstärkung von Lernen wird akzeptiert, um nachzuvollziehen, wie bereits vorhandenes Verhalten gefestigt oder verändert wird.
Offen gelassen wird, wie das jeweilige Verhalten erstmals entsteht. Lernen und Verhalten werden voneinander unterschieden.
Dieser Ansatz ist durch ein interaktionistisches Verständnis geprägt und grenzt sich damit vom behavioristischen Menschenbild des von außen gesteuerten Menschen ab.
Eine Voraussetzung für den Verstärkungsprozess wird z.B. in der weitgehenden Identifikation des Beobachters mit dem Modell gesehen.
Der Mensch wird weder auf die Rolle eines ohnmächtigen Objekts festgelegt, das von Umweltkräften kontrolliert wird, noch erscheint er als freies Subjekt,
das aus sich machen kann, was immer es will. Nach Auffassung von BANDURA determinieren sich Menschen und ihre Umwelt wechselseitig.
Maßgeblich wird nach Auffassung von BANDURA der Erfolg des Modelllernens von vier zentralen Schritten beeinflusst.
Ein Modell muss bestimmte Charakteristika aufweisen, um vom Beobachter als Modell angenommen zu werden. Nur dann kommt es zur Aufmerksamkeitszuwendung,
die Aufmerksamkeitsphase. Nach der Wahrnehmung wird das beobachtete Verhalten in Schemata geordnet, klassifiziert und umgeformt.
Dies wird Behaltensphase genannt. Das Verhalten kann symbolhaft/sprachlich oder als bildhafte Repräsentation gespeichert werden.
In der motorischen Reproduktionsphase kommt es zur konkreten Ausführung der erlernten Verhaltensweisen.
In der Verstärkungs- und Motivationsphase entscheidet der Beobachter, ob das beobachtete Verhalten zur Ausführung gelangt.
Die Ausführung des Verhaltens hängt von den antizipierten Erwartungen des Beobachters ab.
Ein wechselseitiger Zusammenhang von anregenden Modellen, dem ausführenden Verhalten, den kognitiven Verarbeitungsprozessen
sowie der Rückmeldung auf dieses Verhalten bildet das Grundverständnis des Modelllernens.
Problematisch bei diesem Ansatz ist, dass die internen Prozesse des Lernenden von diesem Ansatz nicht genügend reflektiert werden.
Darüber hinaus ist fraglich, ob die zu Grunde liegenden theoretischen Ausgangsüberlegungen des
klassischen (PAVLOV) und des
operanten Konditionierens (SKINNER) den komplexen kognitiven Denkprozessen gerecht werden.
Durch die Überzeugung, dass das Verhalten des Modells als der entscheidende Hinweisreiz für die Nachahmungsreaktion zu betrachten ist,
besteht die Gefahr, eine immanente Beziehung zwischen der beobachteten Botschaft und der selbstidentischen Deutung bei dem Beobachter zu unterstellen
(das Abbild der Wirklichkeit ist identisch mit der beobachteten Wirklichkeit).
Die Möglichkeit, dass auf Grund sozialer und biographischer Erfahrung das Beobachtete anders gedeutet, dekontextualisiert (anders definiert bzw. verstanden) wird,
findet keine Berücksichtigung. Ebenso wird vernachlässigt, dass scheinbar identisches Verhalten (auf der Ebene der Beobachtung) seinen Ursprung in anderen Ursachen haben kann.
In Software-Angeboten wird dieses Lernmodell bei
Animationen und
Simulationsprogrammen angewandt,
so z.B. bei Problemlösungsverfahren, Ablaufstrukturen und der Darstellung von Arbeitsprozessen.


 - Herrschaft durch / der Technik) wird gesprochen,
wenn nicht die Bedürfnisse der Betroffenen über Planungen und Handlungsabläufe bestimmen, sondern allein die technischen Möglichkeiten.Die theoretischen Konzepte der Technokratie werden als Technokratismus bezeichnet. Die Legitimation von Entscheidungen wird nicht von Normen, Bedürfnissen und Überzeugungen abgeleitet, sondern von technologischen »Sachzwängen«.
- Herrschaft durch / der Technik) wird gesprochen,
wenn nicht die Bedürfnisse der Betroffenen über Planungen und Handlungsabläufe bestimmen, sondern allein die technischen Möglichkeiten.Die theoretischen Konzepte der Technokratie werden als Technokratismus bezeichnet. Die Legitimation von Entscheidungen wird nicht von Normen, Bedürfnissen und Überzeugungen abgeleitet, sondern von technologischen »Sachzwängen«.









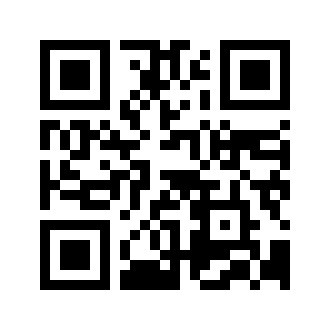


 , lat.: experientia - die Erfahrung) behauptet, dass alles Wissen und unsere Erkenntnisse über die Wirklichkeit aus der Sinneserfahrung stammt.
, lat.: experientia - die Erfahrung) behauptet, dass alles Wissen und unsere Erkenntnisse über die Wirklichkeit aus der Sinneserfahrung stammt.
