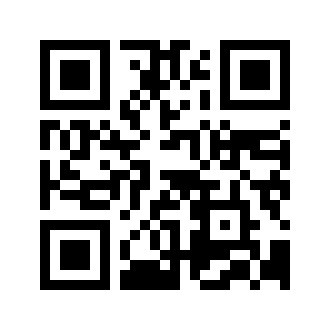Konzepte für Lehrende (K-R)
Der pragmatisch-experimentelle Präferenztyp erwartet von den Lehrenden, dass der zu vermittelnde Lernstoff mit
Handlungswissen verknüpft wird. Bevorzugt beim Lernen werden somit konkrete und handlungsorientierte Methoden.
Das Wissen ist nicht entscheidend, sondern das daraus resultierende Handeln. Im kompetenten Handeln der Wissensträger
wird das Handlungswissen sichtbar. Es geht somit nicht nur um die Vermittlung von Fakten-Wissen, sondern zugleich
um Wissen über Prozeduren, Strategien und Umsetzungsmöglichkeiten.
Personen mit dieser Lernpräferenz verfügen in der Regel über eine überdurchschnittliche logisch-mathematische Intelligenz.
Ebenso ist naturkundliche Intelligenz bei diesem Präferenztyp ausgeprägt.
Der Konstrukteur lässt sich über folgende wissenschaftliche Methoden motivieren :
Experiment und Beobachtung.
Handlungswissen
Handlungswissen ist Wissen, das sich auf konkretes Handeln von Menschen (Praktiken, Techniken, Methoden und Strategien)
bezieht, auf ihre Fertigkeiten (Skills) und ihr »Können« (»Wie ist es anwendbar«).
Handlungswissen oder auch Verfügungswissen beschreibt Methoden zur aktiven Problemlösung und die Fähigkeit zum praktischen Handeln
sowie die Befähigung zum Handeln in konkreten Lebensbezügen (to know how).
Handlungswissen beinhaltet Wissen über Bedingungen, unter denen menschliches Handeln auf sinnvolle Zweck- und Zielsetzungen ausgerichtet wird.
Es geht auch um Wissen über Hilfsmittel, Verfahrensweisen, Kontrollverfahren, Gefahrenquellen und Gütekriterien.
Fähigkeiten, Methoden und Problemlösungen können auch ohne bewussten oder verbalen Verweisungszusammenhang abgerufen werden.
Dieses Wissen basiert wesentlich, aber nicht umfassend auf impliziertem Wissen und beinhaltet vor allem visuelle und räumliche Repräsentationen.
Der Erwerb dieser Wissenskomponenten erfolgt im Wesentlichen durch »Learning by Doing«.
Unterschieden werden kann Handlungswissen in prozedurales Wissen, das befähigt Strategien, Prozeduren und Wege zu entwickeln um
ein gegebenes Problem zu lösen und in ein Faktenwissen, das deklarative Wissen, wie z.B. die Kenntnis über die Eigenschaft eines
Produktes bzw. der Zusammenhang zwischen der Betriebstemperatur einer Maschine und deren Leistungsfähigkeit.
Johannes Moskaliuk verweist darauf,
dass Handlungswissen mit drei spezifischen Situationen verknüpft ist :
- Handlungswissen ist situationsspezifisch, es ist somit mit speziellen Situationen verknüpft. Es wird abgerufen, wenn es benötigt wird.
- Handlungswissen basiert auf Erfahrungen. Es kann nicht über kognitive Prozesse angeeignet werden und kann nicht weitergegeben werden. Jahrelange Erfahrungen sind notwendig um sich dieses Wissen anzueignen.
- Handlungswissen ist stilles Wissen (tacit knowledge, implizites Wissen). Den Handelnden ist es oft nicht bewusst und es ist oft auch nur schwierig zu beschreiben. Es wird intuitiv angewendet.

Logisch-mathematische Intelligenz
Die logisch-mathematische Intelligenz beschreibt die Fertigkeit, mit Zahlen, Mengen, Formeln, mathematischen Gesetzen und mentalen
Operationen umzugehen sowie durch Abstraktionen oder formale Analogien Ähnlichkeiten zwischen Dingen zu erkennen.
Die in der westlichen Welt so betonte logisch-mathematische Intelligenz ist für Gardner eine Fähigkeit, »die ausgezeichnet zur Lösung gewisser
Probleme geeignet, aber anderen in keiner Weise überlegen« ist (2008, S. 158). Diese Intelligenzform ist in der Lage logische und numerische Muster
wahrzunehmen und voneinander zu unterscheiden und kann mit Schlussfolgerungen (logisch) umgehen.
Erkenntnisse darüber, wie wir durch Denkprozesse beim Problemlösen richtige Folgerungen und Beziehungen ableiten, folgerichtige Schlüsse
ziehen oder Beweisketten bilden (und dies nicht nur in mathematischen Aufgabenstellungen), beziehen sich auf diese Intelligenzart.
Wesentlich ist die Fähigkeit, zentrale Probleme zu erkennen und zu lösen. Zu dieser Intelligenz gehört auch die Fähigkeit, Gegenstände und
Abstraktionen einander gegenüberzustellen, zu bewerten und dabei ihre Beziehungen zu grundlegenden Prinzipien zu erkennen.
Wer in der Lage ist Probleme analytisch anzugehen und Situationen auf vorkommende Muster und Regelmäßigkeiten hin untersuchen kann,
verfügt in der Regel über eine logisch-mathematische Intelligenz.
Wissenschaftler, Logiker, Naturwissenschaftler, Computerfachleute und auch Philosophen verfügen über diese Intelligenz.
Dem Physiker Isaac Newton (1643-1727) und dem Astronom
Galileo Galilei (1564-1642) werden eine besonders
ausgeprägten logisch-mathematischen Intelligenz zugeschrieben.
Literatur :
- Howard Gardner : Intelligenzen : Die Vielfalt des menschlichen Geistes. Stuttgart 2008

Naturkundliche Intelligenz
Die naturkundliche Intelligenz beinhaltet Sensibilität für Naturphänomene sowie die Fähigkeit, Unterscheidungen treffen und begründen zu können.
Dazu gehört, die Fähigkeit Pflanzen und Tiere seiner Umgebung zu beobachten, zu unterscheiden, zu identifizieren und zu klassifizieren
sowie Sensibilität für Naturphänomene zu entwickeln. Auch das Erkennen formaler Gesetzmäßigkeiten könnte auf der elementaren Wahrnehmungsfähigkeit
der naturkundlichen Intelligenz beruhen.
Gardner betont, dass in unserer Gesellschaft Personen besonders geschätzt werden, die in der Lage sind, gefährliche / bedrohliche und / oder
Arten mit besonderen Werten zu erkennen sowie neue bzw. bisher unbekannte Lebewesen in ein System zutreffend einzuordnen.
Es gibt eine eindeutige stammesgeschichtliche Bedeutung dieser Intelligenz. Das Überleben von Arten hängt davon ab, in der Lage zu sein
Angehörige der eigenen Art zu identifizieren, den Feinden der eigenen Gruppe auszuweichen, andere als Beuteopfer oder Spielpartner zu erkennen.
Biologen, Botaniker, Förster, Tierärzte und auch Köche beherrschen häufig diese Intelligenzart. Gardner vermutet, dass die elementare
Wahrnehmungsfähigkeit von Künstlern, Dichtern und Naturwissenschaftlern auf der naturkundlichen Intelligenz beruhen.
Zu bekannten Vertretern können Isaac Newton (1642-1729) und
Carl von Linné (1707-1778) gezählt werden.
Literatur :
- Howard Gardner : Intelligenzen : Die Vielfalt des menschlichen Geistes. Stuttgart 2008