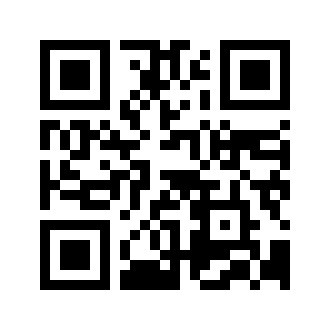Methoden Denker
In dieser Rubrik werden beispielhaft Methoden wissenschaftlichen Arbeitens vorgestellt und zugleich werden
Hilfestellungen gegeben wie sie am geschicktesten zu bearbeiten sind.
Texte bearbeiten
Eine Grundvoraussetzung des Lernens ist die Bearbeitung des geschriebenen Wortes. Es ist hier hilfreich,
sich einiger Grundregeln zu bedienen.
Um sich in einem Text zu orientieren und ihn strukturiert zu erfassen, stehen je nach Intention des Lernenden
unterschiedliche Möglichkeiten zur Verfügung.
Verschiedene Lesetechniken können hier genutzt werden, um grundlegende Informationen herauszufiltern.
Mit Hilfe der Fragetechnik verschafft man sich einen effizienten Einstieg in die Textbearbeitung,
um Lerninhalte sinn-erfassend wiedergeben zu können.
Die Markierungstechnik strukturiert und visualisiert den Text.
Die Exzerpiertechnik fasst den Text zusammen, um ein intensiveres Lernen zu ermöglichen.
In der SQ3R-Methode werden die vorher genannten Methoden in ein klar gegliedertes Konzept eingebunden,
das praxisnah die Erarbeitung eines Textes erleichtert.
Gliederung
Der Text eines Referates, einer Hausarbeit, einer wissenschaftlichen Arbeit oder eines Dokuments sollte klar
gegliedert sein, um den Leser nicht zu irritieren. Absatzanfänge können durch Einzüge, Leerzeilen oder
Formatabstände hervorgehoben oder durch Überschriften herausgestellt werden.
Die Nummerierung und der Text der Überschrift als relativ separate Informationseinheiten sollten optisch
deutlich voneinander abgesetzt sein. Zu viele Gliederungsstufen gilt es zu vermeiden, in der Regel reichen
vier Numerierungsstufen aus.
Mit Hilfe von drucktechnischen Mitteln kann der Aufbau eines Textes sichtbar gemacht werden. Mittels Absätzen,
Bemerkungen, Nummerierungen, Tags und Hervorhebungen (Schriftart, Schriftgröße usw.) können zusammengehörige
Teile übersichtlich gruppiert werden.
Folgende Links geben weitere Infos:
Sie wird häufig im Rahmen des Neurolinguistischen Programmierens eingesetzt und vor allem in NLP-Ausbildungen
gelehrt. Diese Methode kann sowohl von einer Einzelperson, als auch von einer Gruppe angewandt werden.
Für die Erarbeitung seiner Ziele und Lösungen durchlief der Gründer und Namensgeber einen eigenen kreativen
Prozess von drei verschiedenen Phasen: dem Träumen, dem Planen und der Kritik.
Die Walt-Disney-Methode folgt diesem Modell. Die Teilnehmer schlüpfen dabei nacheinander in drei verschiedene
Rollen. Jede der drei Phasen steht dabei gleichberechtigt neben den anderen und trägt in gleichem Maße zur
erfolgreichen Lösung einer Aufgabe bei. Für jede der drei Positionen sollte ein Platz gefunden werden, der
die Teilnehmer darin unterstützt, einen günstigen Denk- und Gefühlszustand für die jeweilige Rolle zu
erlangen.
Denn es ist nicht immer leicht, und anfangs sehr ungewohnt, völlig in die verschiedenen Rollen zu schlüpfen.
Ein Ortswechsel erleichtert dies ungemein. Ziel der Walt-Disney-Strategie ist es, die Anteile des Träumers,
des Realisten und des Kritikers in ein Gleichgewicht zu bringen, um zu einer erfolgreichen Lösungsstrategie
zu gelangen.
Der Träumer (Visionär, Ideenlieferant)
Der Träumer entwickelt Fiktionen. Er träumt in Bildern und greift auch gerne die Träume anderer auf. Er sieht
große Visionen, die sich wie in einem Film zusammensetzen. Killerphrasen und Regeln hindern ihn daran nicht.
Fragen, mit denen sich der Träumer auseinandersetzt:
- Was wünsche ich mir?
- Wovon träume ich? Was ist der beste Fall?
Der Realisierer (Planer, Macher)
Der Realisierer hat die Aufgabe, die Ideen des Träumers zu testen, bevor sie vom Kritiker geprüft werden.
Der Realisierer konzentriert sich auf das konkrete und gegenwärtige praktische Tun. Er stellt sich möglichst
realistisch die Umsetzung der Ideen des Träumers vor und stellt sich Fragen wie
- Wie kann ich das umsetzen?
- Was muss ich tun oder sagen?
- Was benötige ich dazu (Menschen, Wissen, Fähigkeiten, Material)?
- Wie fühle ich mich dabei?
- Was ist bereits vorhanden?
Daraus wird ein vollständiger Plan erarbeitet: Maßnahmen werden notiert, die notwendig sind, um das Ziel
zu erreichen. Es werden Mittel und Möglichkeiten aufgelistet, die bereits vorhanden sind und die noch
benötigt werden. Wichtige Kontakte, alle Ressourcen, notwendige Qualifikationen, fehlende Inputs, etc.
gehört weiterhin in den Plan der Realisierung.
Der Kritiker (Qualitäts-Manager, Fragensteller)
Die Aufgabe des Kritikers ist es, konstruktive Fragen zu stellen. Die Basis ist die Analyse der Umsetzung
des Realisierers. Der Kritiker sucht nach Fehlern und Schwachpunkten im Plan. Er ist sehr kritisch und will
nicht nett sein. Was hält er für möglich? Was kann gar nicht funktionieren? Was ist einfach Träumerei?
Er stellt sich selbst Fragen (innerer Dialog) wie
- Was könnte verbessert werden?
- Was sind die Chancen und Risiken?
- Was wurde übersehen?
- Wie denke ich über den Vorschlag?
und formuliert aus den Ergebnissen die Fragen, die er an den Träumer weitergibt.
Der Träumer macht weiter und erarbeitet aus den bisherigen Ergebnissen neue Visionen. Er nimmt sich die
Kritik Punkt für Punkt vor und erweitert sein Ziel, bis sich die Kritik auflöst. Wenn der Kritiker anmerkte,
dass die vorhandene Zeit nicht ausreicht, dann könnte die Vision um Mitarbeiter zur Unterstützung erweitert
werden.
Dies wiederholt sich so lange, bis der »Kritiker« keine relevanten Fragen mehr stellen kann und keine Kritik
mehr anbringen kann. Dann liegt ein originelles oder einmaliges, funktionelles Ergebnis vor.
Der Auftrag, in verschiedene Rollen zu schlüpfen und der jeweiligen Aufgabe zu entsprechen, ermöglicht ein
optimales, hilfreiches
Feedback.
Denn Feedback wird so nicht als persönliche Kritik
aufgefasst. Die Walt-Disney-Methode kann mit oder ohne Moderator durchgeführt werden. Er sorgt dafür, dass
die einzelnen Personen ihre jeweilige Rolle, Träumer, Realisierer oder Kritiker, nicht verlassen. Denn beim
Träumen wird häufig bereits an die Umsetzbarkeit gedacht und beim Planen denkt man an die viele Arbeit und
an die Kritik anderer. Bei einem eingespielten und darin erfahrenen Team ist ein Moderator nicht zwingend
nötig.