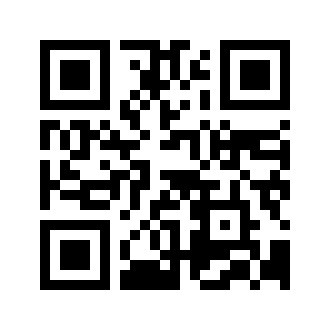Konzepte für Lehrende
Der organisatorisch-strukturelle Präferenztyp erwartet von den Lehrenden vor allem Nachvollziehbarkeit,
Sinnhaftigkeit und Verständlichkeit des zu vermittelnden Lernstoffes. Wichtig ist es die jeweiligen Inhalte
zu bereits bekannten Strukturen bzw. Wissensbausteinen in Bezug zu setzten. Da der Lernende eine klare
Struktur bevorzugt, dienen vor allem Kontextwissen und
Orientierungswissen als wichtige Anker für diesen Präferenztyp.
Vorteilhaft ist es für ihn, wenn er das zu Lernende anhand von Quellen nachvollziehen kann, daher hat auch
das Quellenwissen Bedeutung. Da dieser Präferenztyp auch stark von Prinzipien
geleitet ist, hilft es dem Lernenden, wenn er Kenntnisse von Prinzipienwissen
hat bzw. aufbauen kann.
Hilfreich sind Kenntnisse im Umgang mit Relationen
und Statistik
und deren Einbindung in die Lernprozesse. Methodisch aufbereitete Daten erreichen den Verwalter.
Kontextwissen
Das Kontextwissen spielt u.a. bei der kognitionspsychologischen Lerntheorie eine wichtige Rolle. Dieses
Wissen wird benötigt, um eine Beobachtung, ein Objekt oder einen Begriff in einen bekannten Zusammenhang
(Kontext) zu integrieren (to know the context).
Mit dem Kontextwissen wird auch der Grad an Wissen bestimmt, über den ein Mensch in einem Wissensgebiet
verfügt. Das Kontextwissen bestimmt maßgeblich, wie gut sich Wissen zwischen Wissensträgern weitergeben lässt.
Es lässt sich unterscheiden in die Herstellung von semantischen Bezügen und in die implizite Kompetenz der
Zuordnung. Kontextwissen bedeutet, z.B. das Wort »Links«, im entsprechenden Zusammenhang, als Hinweis auf
einen Hypertext und nicht als Richtungshinweis zu interpretieren.
Die strategische Verknüpfung von Kontexten wird Relationen genannt. Hier geht es um
semantische Verknüpfungen von unterschiedlichen Textbausteinen oder Modulen.

- RelationRelation kommt aus dem Lateinischen (relatio) und hat die Ursprungsbedeutung »das Zurücktragen«. Allgemein kommt ihr die Bedeutung zu eine bestimmte Beziehung zwischen Objekten oder Ereignissen zu kennzeichnen. In der Mathematik wird unter Relation die Behandlung einer eindeutigen Beziehung zwischen den Dingen verstanden. In der Informatik (Datenbank) bezeichnet Relation eine zweidimensionale Tabelle zur Speicherung von Werten.
-
Die Begriffe »Struktur« und »System« stehen in engem Zusammenhang mit dem Begriff Relation. Die Menge aller Relationen zwischen den einzelnen Elementen eines Systems wird in der Systemtheorie unter der Struktur eines Systems verstanden.Differenziert werden kann zwischen konstruierten Beziehungen (relatio rationis) und realen Beziehungen (relatio in natura). Wenn Objekte sich in irgendeiner Form tatsächlich aufeinander beziehen wird dies als reale Beziehungen bezeichnet. Wenn Objekte hinsichtlich ihrer Größe, Lage bzw. Existenzdauer in Beziehung gesetzt werden, werden sie konstruierte (gedachten) genannt.Begriffe bestehen nicht isoliert, sondern sind miteinander verknüpft. Die Beziehung zwischen den Begriffen werden semantische Relationen genannt. In der Informationswissenschaft werden in Anlehnung an Ferdinand de Saussure semantische Relationen unterteilt in paradigmatische (assoziative) und syntagmatische (Anreihung-)Beziehungen. Erstere ist durch die Dokumentationssprache vorgegeben. Letztere beruht auf zwei oder mehrere in einer Reihenfolge nebeneinander vorhandenen Gliedern. Es handelt sich um „fest verdrahtete“ Beziehungen. Die Wissensordnung ist festgelegt.Die syntagmatische Beziehung wird auf einer horizontalen Ebene definiert, die paradigmatische Beziehung auf einer vertikalen Ebene.Beispiel:
Monika- läuft
- rennt
- schläft
- sitzt
- spaziert
Syntagmatisch: Beziehung zwischen Monika, läuft, im und ParkParadigmatisch:- durch Austauschbarkeit definiert (hier: läuft, rennt, schläft, sitzt ...)
- die paradigmatisch aufeinander bezogenen Einheiten können im selben Kontext vorkommen, können aber auch in Opposition zueinander stehen.

Orientierungswissen
Orientierungswissen gibt Antworten auf die Frage: »Was gibt es überhaupt?« Dieses Wissen wird benötigt,
um sich auf einem bestimmten Gebiet zurechtzufinden, ohne in spezifischer Weise tätig zu werden.
Orientierungswissen gibt einen Überblick über ein Thema und stellt Kontexte her. Wer Orientierungswissen hat,
kennt den entsprechenden Sachverhalt nur an der Oberfläche. Es lädt zu weiteren Entdeckungen ein und regt die
Aufmerksamkeit an. Zur Orientierung eignen sich Szenarien, Geschichten und Fakten.
Beim Orientierungswissen handelt es sich um Sachwissen. In diesem Kontext wird Wissen verstanden als Zunahme
der Kenntnisse über Daten und Fakten (to know what). Das Orientierungswissen lässt sich weiter differenzieren
in ein Überblick verschaffendes- und ein konzeptuelles Wissen. Mit Konzeptwissen
ist die Befähigung gemeint, auf Grund von Erfahrungen und begrifflichen Ausdrucksformen Konzepte zu entwerfen
und damit über Begriffe, Ideen und Modelle sinnvolle Zusammenhänge zu erschließen. Ebenso lassen sich unter
diesem Aspekt die Kenntnisse von Regeln, Programmen und Gesetzen zusammenfassen
(Prinzipienwissen).