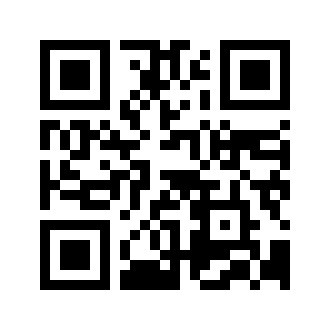Wissenschaft Kommunikator
In dieser Rubrik werden Kontexte zu fachwissenschaftlichen Diskursen hergestellt. Hinweise sollen gegeben werden auf Forschungstraditionen, deren
Ergebnisse nachvollziehbar machen, warum dieser Lernpräferenztyp durch pragmatisch-experimentelle Anregungen Impulse zum Lernen bekommt.
Wenn es auch keine Zweifel gibt, dass Emotionen ein grundlegender Bestandteil unseres menschlichen Wesens sind, tut sich die
Wissenschaft schwer, diesen Begriff eindeutig zu definieren. Während ein Teil der in Emotionen von Umweltgegebenheiten ausgelöste Reizreaktionsmuster
sehen, erkennen Andere nicht beeinflussbare neurophysiologische Reaktionen, die im Gehirn stattfinden. Eine dritte Gruppe wiederum ist der Überzeugung,
dass es sich bei Emotionen um soziale Konstruktionen handelt.
Bei Kommunikation handelt es sich nicht nur um einen Austausch oder die Übertragung von Informationen, sie ist zugleich
der Grundvorgang zwischenmenschlicher Interaktionen. Sie ist einer der komplexesten und Bedeutendsten Fähigkeiten des Menschen. Da ein Großteil der
bei einem kommunikativen Austausch genutzten Kanäle über Gesten, Körperhaltung, Mimik oder Betonung vermittelt werden, gibt es Überschneidungen mit
anderen Lernpräferenztypen (kinästhetische, visuelle oder akustische Wahrnehmungsweisen).
Emotionen
Emotionen sind unwillkürliche Reaktionen des Körpers auf bestimmte Situationen. Wenn wir diese Emotion bewusst wahrnehmen, sprechen wir von Gefühlen.
Emotionen können sich auf mehreren Ebenen bemerkbar machen:
- als Gefühl (Begleiterscheinung einer Emotion),
- als Verhalten (Mimik, Gestik, Körpersprache),
- als körperliche Veränderung (Schweißausbrüche, Muskelverspannung),
- als Kognition (Erwartung, dass etwas Schlimmes passieren könnte).
Es gibt fünf verschiedene Ansätze, um Emotionen wissenschaftlich zu erklären:
- Evolutionsbiologische Ansätze (DARWIN) gehen davon aus, dass Emotionen angeborene Reste der menschlichen Entwicklungsgeschichte sind. Ursprünglich hatten sie eine Schutz- und Signalfunktion.
- Psychophysiologischer Ansatz (SCHACHTER & SINGER; JAMES & LANGE): Hier werden die körperlichen Veränderungen im peripheren und zentralen Nervensystem untersucht, während eine Person Emotionen erlebt.
- Behavioristisch-Lerntheoretischer Ansatz (WATSON): Dieser Ansatz versteht Emotionen als eine Art von angeborenem Reiz-Reaktions-Muster. Die ursprünglichen Emotionen (Wut, Zorn und Liebe) werden im Laufe der Entwicklung mittels klassischer Konditionierung ergänzt.
- Kognitive Bewertungstheorien (LAZARUS) folgen der Überzeugung, dass nicht die Reize an sich, sondern die individuellen Einschätzungs- und Bewertungstendenzen bezogen auf Ereignisse oder Situationen, die das Wohlbefinden tangieren, emotionale Reaktionen auslösen.
- Funktionalistisch orientierte Komponenten-Prozess-Modelle (LEVENTHAL): Emotionen werden als Produkte verschiedener Verarbeitungsschritte auf unterschiedlichen Verarbeitungsebenen angesehen. Der ursprüngliche, phylogenetisch entstandene Anpassungsmechanismus reflexhaft miteinander verbundener Reaktionen und auslösender Reize wird durch eine flexible Anpassung an hoch komplexe soziale und physikalische Umwelten erweitert. Emotionen stehen somit im Dienste der Handlungsregulation.
Inzwischen ist bekannt, dass Emotionen eine ganz entscheidende Bedeutung für das Lernen haben. Aus diesem Grunde ist es vorteilhaft, wenn die
Lernenden grundlegende Kenntnisse über »Emotionen« erlangen. Zwischen Emotion und Kommunikation,
Emotion und Kognition, kognitiven Funktionen und Fähigkeiten (Wahrnehmung, Denken und Gedächtnis) sowie zwischen
Emotion und Motivation bestehen wechselseitige Beziehungen, die das Verhalten und Erleben eines Menschen steuern.
Den Emotionen kommt dabei die zentrale Aufgabe zu, die Steuerung des Aufmerksamkeitsfokus zu motivieren und den vorbewussten sensorischen Input
hinsichtlich seiner Bedeutung für den Organismus zu bewerten. Dadurch ist es möglich, trotz komplexer sozialer Zusammenhänge sinnvoll zu entscheiden.
Allerdings ist damit die Konsequenz verbunden, dass alle wahrgenommenen und vorgestellten Gegenstände nie neutral gesehen werden können, sondern immer
bereits bewertet und damit mit Sinn aufgeladen sind.
Linkempfehlungen :

- Emotion und KognitionEmotionen beeinflussen in einem nicht unerheblichen Maß kognitive Funktionen und Prozesse. SPENCER (1890) geht davon aus, dass kognitive Prozesse nur sehr selten frei von Emotionen sind.Die Mehrzahl der emotionalen Erregungen werden kognitiv bewertet und in Folge als Freude, Ärger, Sehnsucht, Enttäuschung oder Trauer erlebt. Die Wahrnehmung von Emotionen hängt dabei immer von der kognitiven Bewertung des Erregungszustandes ab.
-
Die emotionalen Prozesse stellen für das Funktionieren kognitiver Prozesse die Energie bereit. IZARD ist demnach überzeugt davon, dass emotionale Prozesse unabhängig von kognitiven ablaufen können, aber umgekehrt sei dies nicht möglich. PLUTCHIK geht von einer parallelen Entwicklung des kognitiven und emotionalen Systems des Gehirns aus. Die aktuelle neurophysiologische Forschung bestätigt diesen Hinweis. Bei einer bestimmten Schädigung des Gehirns im Bereich des präfrontalen Cortex geht z.B. die Befähigung Emotionen zu empfinden verloren. Diese Komplementarität lässt von einer so genannten emotionalen Intelligenz ausgehen.Indem sie beeinflussen, wem oder was wir Aufmerksamkeit schenken, wie wir uns selbst und andere wahrnehmen und wie wir verschiedene Merkmale von Lebenssituationen interpretieren und erinnern, dienen Emotionen den kognitiven Funktionen.Welche Rolle Emotionen bei der Informationsverarbeitung zukommt hat zuerst BOWER (1981) untersucht. Nach seinen Ergebnissen führen erlebte Emotionen zu einer stimmungsabhängigen Verarbeitung bzw. zu einem stimmungsabhängigen Abruf von Informationen.Stimmungsabhängige Verarbeitung findet statt, wenn Menschen selektiv zur Aufnahme von Informationen sensibilisiert werden, die mit ihrer momentanen Stimmung deckungsgleich sind.Stimmungsabhängiges Abrufen kommt dann zustande, wenn die Person wieder in der gleichen Stimmung ist wie bei einem früheren Ereignis. Unangenehme Emotionen dagegen hemmen kognitive Prozesse und fördern kognitive Vorgänge, die ihnen entgegenarbeiten.Auch auf Gedächtnisinhalte üben Emotionen einen Einfluss aus: Affektiv getönte Ereignisse werden besser behalten als nicht affektiv getönte. Langfristig ist anzunehmen, dass man angenehme Ereignisse besser behält als unangenehme. Somit fördern angenehme Gefühle und Bedürfnisse kognitive Prozesse, die diese Gefühle und Bedürfnisse unterstützen. Gefühle sind aber auch in der Lage, kognitive Funktionen und Fähigkeiten zu blockieren. Dies gibt Hinweis auf eine unauflösliche Einheit zwischen Großhirnrinde und limbischem System.

- Emotion und MotivationEmotion und Motivation sind sehr eng miteinander verflochten. Psychische Vorgänge haben sowohl eine Befindlichkeitsseite als auch eine Antriebsseite. Wird die momentane Erlebnislage betont, spricht man von Emotion oder Gefühl, steht die Zielorientierung im Vordergrund, wird von Motivation gesprochen.Eine wichtige Funktion von Emotionen ist, Menschen dazu zu bringen, sich auf wichtige Ziele hin zu bewegen. Die durch die physiologische Erregung ausgelöste emotionale Situation kann erforderlich sein, um uns zu einer angemessenen Reaktion zu bewegen.
-
Die motivationale Funktion der Emotion liegt in:
- der Steigerung der Flexibilität des Verhaltens (Reaktion auf Reiz),
- der Unabhängigkeit von festgelegten Handlungsmustern und
- dem subjektiven Gefühl, etwas zu tun/nichts zu tun.
Jeder Mensch hat sein eigenes Gefühlsmuster. Es ist ausschlaggebend für seine Persönlichkeit.DECI/RYAN (1993) gehen von drei angeborenen psychologischen Bedürfnissen aus, die für die Lernmotivation entscheidend sind:- dem Bedürfnis nach Kompetenz und Wirksamkeit,
- dem Bedürfnis nach Autonomie und Selbstbestimmung und
- dem Bedürfnis nach sozialer Eingebundenheit und sozialer Zugehörigkeit.
Die Motivations-Psychologie versucht zu erklären, unter welchen Bedingungen diese Einsicht entsteht und welche unterschiedlichen Qualitäten die Lernmotivation annehmen kann. Weitere Informationen sind der Power Point Präsentation Emotion und Motivation von www.learn-line.nrw.de zu entnehmen sowie folgenden Internetseiten: