
Wissenschaft Ästhet
In dieser Rubrik werden Verbindungen zu fachwissenschaftlichen Diskursen hergestellt. Hinweise sollen
gegeben werden auf Forschungstraditionen, deren Ergebnisse nachvollziehbar machen, warum dieser
Lernpräferenztyp durch visuell-ästhetische Anregungen Impulse zum Lernen bekommt.
Susanne Langer hat in ihrem Buch
»Philosophie auf neuem Wege. Das Symbol im Denken, im Ritus und in der Kunst« (1965) unterschieden zwischen
zwischen »diskursiver« und »präsentativer Symbolisierung«. Die präsentative Symbolisierung ermögliche
Artikulationen, die sich der diskursiven Logik widersetze. Diese Differenzierung wurde zur Grundlage ihrer
ästhetischen Theorie.
Die Gestaltpsychologie ist eine Forschungsrichtung, deren Wurzeln in das 19. Jahrhundert reichen. Ihre
besondere Entfaltung erfuhr sie in den
20er bis 40er Jahren des letzten Jahrhunderts in Deutschland. Ihr Anliegen ist es Gesetzmäßigkeiten zu finden,
mit deren Hilfe man Bilder und/oder Szenen immer nur in einer bestimmten Art und Weise wahrnehmen kann.
Die Hemisphärenforschung setzt sich mit den unterschiedlichen Arbeitsweisen der beiden Hemisphären unseres
Gehirns auseinander. Dieser Forschungszweig, kann erklären welche Vorgänge im Gehirn den Menschen in die
Lage versetzen, ein ästhetisches Urteil zu fällen. Zugleich wird durch sie verdeutlicht, dass die
multioptionale Fähigkeit unseres Gehirnes nur dann optimal genutzt wird, wenn es zu einem permanenten Dialog
zwischen den beiden Hemisphären kommt.
Literatur :
- Langer, Susanne: (1942): Philosophie auf neuem Wege. Das Symbol im Denken, im Ritus und in der Kunst. Frankfurt/M 1987.
Präsentativer Symbolismus
Die Sprache ist nach Auffassung von Susanne Langer
keinesfalls unsere einzige artikulierte Hervorbringung. Jenseits der Diskursivität gibt es Phänomene, die
sich nicht in einem »logischen Jenseits« befinden. »Unsere Sinneserfahrung ist bereits ein Prozeß [sic]
der Formulierung« (Langer 1987, S. 95). Aus dem Chaos der Sinnesempfindungen müssen unsere Sinnesorgane
Formen auswählen. Augen und Ohren scheinen das sensorische Feld nach bestimmten Mustern und Sinnesdaten zu
gliedern. Aus diesem Grund wächst den Formen Bedeutung zu.
Unserem Empfangsapparat wohnt eine Tendenz inne, das sensorische Feld in bestimmte Muster von Sinnesdaten zu
gliedern. Sobald die Außenwelt auf unsere Rezeptoren wirkt, beginnt bereits »das Geistige« in der Tätigkeit
unserer Sinne. Aus der Flut von Lichteindrücken werden Formen wahrgenommen. Die Formen der Wahrnehmung, die
intuitiv und unbewusst vollzogenen Abstraktionen, entsprechen den primitivsten Instrumenten unserer
Intelligenz. »Sie sind echtes symbolisches Material, Medien des Verstehens, durch deren Vermittlung wir
eine Welt von Dingen und von Ereignissen erfassen, die die Geschichte der Dinge sind« (ebd., S. 98).
Langer vermutet einen unbewussten »Sinn für Formen«, der die Wurzel aller Abstraktion ist (ebd, S. 93).
Diese Abstraktionsfähigkeit ist wiederum die Bedingung für Rationalität. Rationalität ist daher tief
verankert in unserer animalischen Erfahrung, »in unserer Wahrnehmungsfähigkeit, in den elementaren
Funktionen unserer Augen, Ohren und Finger« (ebd., S. 96). Der Stempel des Geistigen trägt alle
Sensitivität, das geistige Leben beginnt schon mit unserer physiologischen Konstitution. Sich beziehend auf
die Gestaltpsychologie von Wolfgang Köhler
und Max Wertheimer konstatiert sie
die geistige Tätigkeit unserer Sinne von Anbeginn an. Dementsprechend ist Sehen kein passiver Vorgang,
sondern selber schon ein Formulierungsprozess. »Unser Verständnis der sichtbaren Welt beginnt im Auge«
(ebd., S. 97).
Die grundlegenden Wahrnehmungsformen, die die elementaren Abstraktionen des von unseren Sinnen erfassten
symbolischen Materials liefern, gehören nach Auffassung von Langer der präsentativen Ordnung an. »Visuelle
Formen - Linien, Farben, Proportionen usw. - sind ebenso der Artikulation, d.h. der komplexen Kombination
fähig wie Wörter. Aber die Gesetze, die diese Art von Artikulation bestimmen, sind von denen der Syntax, die
die Sprache regieren, grundverschieden. Der radikalste Unterschied ist der, dass visuelle Formen nicht
diskursiv sind. Sie bieten ihre Bestandteile nicht nacheinander, sondern gleichzeitig dar, weshalb die
Beziehungen, die eine visuelle Struktur bestimmen, in einem Akt des Sehens erfaßt [sic] werden« (ebd., S.
99).
Während zwischen Anzeichen und Symbol ein logischer Unterschied besteht, weist die von Langer vorgenommene
Unterscheidung zwischen diskursiven und präsentativen Strukturen formale Verschiedenheit auf. Im strengen
Sinne ist Sprache ihrem Wesen nach diskursiv. Die Sprache hat festgelegte Äquivalenzen, besitzt permanente
Bedeutungseinheiten, die zu größeren Einheiten verbunden werden können. »Die durch die Sprache übertragenen
Bedeutungen werden nacheinander verstanden und dann durch den als Diskurs bezeichneten Vorgang zu einem
Ganzen zusammengefaßt[sic]; die Bedeutungen aller anderen symbolischen Elemente, die zusammen ein größeres,
artikuliertes Symbol bilden, werden nur durch die Bedeutung des Ganzen verstanden, durch ihre Beziehung
innerhalb der ganzheitlichen Struktur. Daß sie überhaupt als Symbole fungieren, liegt daran, daß sie alle zu
einer simultanen, integralen Präsentation gehören. Wir wollen diese Art von Semantik präsentativen
Symbolismus nennen, um seine Wesensverschiedenheit vom diskursiven Symbolismus, das heißt von der
eigentlichen Sprache zu charakterisieren« (ebd., S. 103). Der präsentative Symbolismus reicht von den
elementaren intuitiven Abstraktionen der Gestalterkennung (Bilder, Metaphern) über den Traum, Ritus, Musik,
Mythos, die Bereiche der Phantasie und der Emotionen bis zur bildenden Kunst. Präsentativ meint alle nicht
den logischen Gesetzmäßigkeiten der Sprache gehorchenden, simultanen integralen Präsentationen.
Quelle :
- Röll, Franz Josef (1998): Mythen und Symbole in populären Medien. Der wahrnehmungsorientierte Ansatz in der Medienpädagogik. Frankfurt.
Literatur :
- Langer, Susanne: (1942): Philosophie auf neuem Wege. Das Symbol im Denken, im Ritus und in der Kunst. Frankfurt/M 1987.

Gestaltpsychologie
Die Gestaltpsychologie geht von dem Leitsatz aus, dass das Ganze mehr ist als die Summe seiner Teile. Der
Überblick über die gesamte Problemsituation gilt daher als Voraussetzung für das Problemlösen, da nur dann
die Befähigung gegeben ist die Teile zu einem Gesamtbild zusammenzufügen.
Die Gestaltpsychologie lehrt, dass die Formwahrnehmung über das Erfassen des visuellen Reizes hinausgeht.
Formen, Figuren oder Gestalten sind dieser Theorie gemäß das Ergebnis von Prozessen der Gliederung und
Herstellung von Zusammenhängen im Wahrnehmungsfeld. Indem ich wahrnehme, trenne ich eine Figur von einem
Hintergrund. Bestimmte Elemente werden von unserem visuellen System als Figuren aufgefasst, während das
übrige visuelle Feld als Hintergrund interpretiert wird. Diese Leistung des Wahrnehmungssystems gilt als
Voraussetzung für sichere und schnelle Orientierung und wird Figur-Grund-Unterscheidung genannt. Abhängig
ist die Unterscheidung von Figur und Grund von der Bildung von Gestalten.
Die Gestalttheoretiker Max Wertheimer,
Wolfgang Köhler,
und Kurt Koffka haben bei ihren
Untersuchungen u.a. folgende Gesetzmäßigkeiten herausgearbeitet:
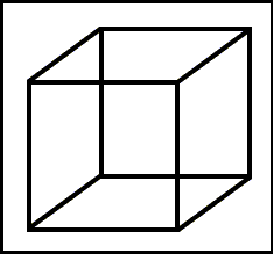
Nach längerer Betrachtung »kippt« der Würfel. Dieses »Kippen« wird als Gestaltwechsel bezeichnet.
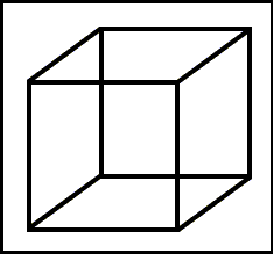
Nach längerer Betrachtung »kippt« der Würfel. Dieses »Kippen« wird als Gestaltwechsel bezeichnet.
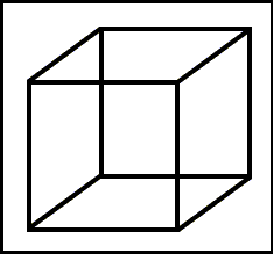
»Die Kanten des Würfels sind imaginär; sie werden von unserem Gehirn nach dem Gesetz der guten Fortsetzung
erzeugt.«
Einsicht ist nach Auffassung der Gestaltpsychologie die Voraussetzung für das Problemlösen. Ein Mensch löst
demgemäß ein Problem, wenn er in der Lage ist, eine Beziehung zwischen den Elementen einer Problemsituation
wahrzunehmen.
Die Gestaltpsychologie lehrt, dass die Formwahrnehmung über das Erfassen des visuellen Reizes hinausgeht.
Formen, Figuren oder Gestalten sind dieser Theorie gemäß das Ergebnis von Prozessen der Gliederung und
Herstellung von Zusammenhängen im Wahrnehmungsfeld. Indem ich wahrnehme, trenne ich eine Figur von einem
Hintergrund. Bestimmte Elemente werden von unserem visuellen System als Figuren aufgefasst, während das
übrige visuelle Feld als Hintergrund interpretiert wird. Diese Leistung des Wahrnehmungssystems gilt als
Voraussetzung für sichere und schnelle Orientierung und wird Figur-Grund-Unterscheidung genannt. Abhängig
ist die Unterscheidung von Figur und Grund von der Bildung von Gestalten. Die Gestalttheoretiker haben bei
ihren Untersuchungen folgende Gesetzmäßigkeiten herausgearbeitet:
- Gesetz der Ähnlichkeit: Einander ähnliche Elemente werden eher als zusammengehörig erlebt als einander unähnliche.
- Gesetz der Nähe: Elemente mit geringen Abständen zueinander werden als zusammengehörig wahrgenommen.
- Gesetz der Kontinuität übereinstimmendes Verhalten: Gesetz der (objektiven) Einstellung (frühere Gruppierungen werden bevorzugt).
- Gesetz des Aufgehens ohne Rest Abstoßung oder Ergänzung: Gesetz der durchgehenden Kurve (des glatten Verlaufs).
- Gesetz der Geschlossenheit: Linien, die eine Fläche umschließen, werden unter sonst gleichen Umständen leichter als eine Einheit aufgefasst als diejenigen, die sich nicht zusammenschließen.
Es gibt nach Auffassung der Gestaltpsychologie eine Tendenz unseres Wahrnehmungssystems, unser
Wahrnehmungsfeld möglichst einfach zu strukturieren, das so genannte Gesetz zur guten Gestalt
(Prägnanzeffekt). Wenn Teile und Einheiten eines Musters auf einer Linie liegen oder ihre Richtungen nur
geringe Abweichungen aufweisen, unterstellen wir eine stetige Fortsetzung. Bei abrupten Richtungsänderungen
interpretieren wir Konturen als nicht zusammengehörig. Demgemäß deckt unser Wahrnehmungssystem im visuellen
Reizmuster objektive Strukturen und Gruppierungen unserer Umwelt auf.
Linkempfehlungen :

Hemisphärenschichtforschung
Die Vermutung, dass in unserem Gehirn unterschiedliche Areale für spezifische Fähigkeiten zuständig sind,
wurde bereits im 19. Jahrhundert geäußert. 1861 wies Paul Broca
nach, dass es in unserem Gehirn ein Sprachzentrum gibt. Etwa zehn Jahre später fanden Forscher heraus, dass
die rechte bzw. linke Gehirnseite die jeweils gegenüberliegende Körperhälfte beeinflussen.
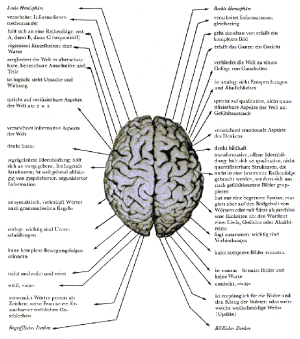
Quelle: Gabriele L. Rico: Garantiert schreiben lernen. Reinbek 1987, S. 70
Unsere Großhirnrinde besteht aus zwei Hemisphären, die voneinander getrennt sind. Maßgeblich wurde die
Vorstellung, dass die beiden Hemisphären für unterschiedliche Aktivitäten zuständig sind, von der von
Roger Sperry
(1974) und John Carew Eccles
(1993) entwickelten Split-Brain-Forschung
geprägt. Sie konnten
beobachten, dass es Prozesse gibt, bei denen beide Gehirnregionen unterschiedlich aktiv sind. Bei einzelnen
Prozessen wurden spezielle Areale bevorzugt aktiviert. Nach deren Erkenntnissen ist die die linke Hemisphäre
für analytisches, logisches, rationales, lineares und sprachliches Denken zuständig, wohingegen die rechte
für ganzheitliches, bildhaftes, kreatives und intuitives Denken zuständig ist.
Vernachlässigt werden darf nicht, dass es sich bei diesem Konzept um ein Denkmodell handelt, das am ehesten
für den Rechtshänder zutrifft. Da in unserer Gesellschaft Rechtshänder überwiegen, ist es durchaus sinnvoll,
die Prämissen dieser Theorie nicht außer Acht zu lassen. Bei etwa 95% der Rechtshänder und etwa 60% der
Linkshänder ist die linke Hemisphäre Träger der sequentiellen Informationsverarbeitung, welche beim
Sprachverstehen, Sprechen und logischen Denken dominiert. Von einer universellen Zuordnung von bestimmten
Fähigkeiten und entsprechenden Gehirnregionen sollte jedoch nicht ausgegangen werden.
Physiologisch gesehen ist die linke Gehirnhälfte zum größten Teil aus vielen kurzen neuronalen Verbindungen
zusammengesetzt, in der rechten überwiegen die langen Verbindungen. Beide Gehirnteile sind durch das Corpus
Callosum verbunden. Das Corpus Callosum (der Balken) ist der zentrale Gewebebereich in unserem Gehirn, über
den die beiden Hemisphären Informationen miteinander austauschen. Es besteht aus mehreren Millionen
Nervenfasern.
Bei vielen Aktivitäten, so z.B. bei der Sprache, kommt es zu einem Zusammenspiel beider Hemisphären. So ist
z.B. der Wortschatz in der linken Hemisphäre verankert, während die (semantische) Bedeutung der einzelnen
Worte meist in der rechten Gehirnhälfte zu finden ist.
Die Hemisphärenschichtforschung gibt den Wissenschaftlern immer noch Rätsel auf. Während relativ klar ist,
welche Aufgaben die linke Hemisphäre übernimmt, kennt man die Funktionen der rechten Hemisphäre erst grob.
Linkempfehlungen :









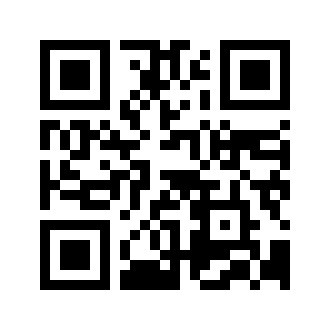


 aísthesis »Wahrnehmung«, »Empfindung«) wird einerseits die
aísthesis »Wahrnehmung«, »Empfindung«) wird einerseits die 
