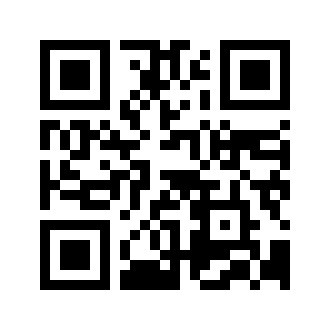Konzepte für Lehrende
Der visuell-ästhetische Präferenztyp erwartet von den Lehrenden eine Darstellung des Lernstoffs bei dem
vor allem der Sehsinn beteiligt ist. Die Auffassungsgabe des Ästheten wird angeregt, wenn der Lernstoff
ästhetisch aufbereitet ist oder ästhetische Methoden (Erfahrungen) bei der Erarbeitung des Lernstoffs
Verwendung finden. In- und Output-Lernen fällt diesem Präferenztyp schwer, einfacher lernt er wenn
assoziative Lernmethoden (siehe Methoden) eingesetzt werden.
Bedeutsam ist, sich mit den Potentialen des anschaulichen Denkens
auseinander zu setzten, dazu gehört auch sich bewusst zu machen, dass es neben dem Begriffsdenken das
Bild-Denken gibt. Die Auseinandersetzung mit der
ästhetischen Erfahrung
kann dazu beitragen, zu verstehen wie es
gelingen kann neue Perspektiven, Ansichten oder Denkmodelle zu vermitteln, ohne dass die Lernenden innere
Widerstände zu überwinden haben.
Kenntnisse von pädagogischen Konzepten, die propagieren mit allen Sinnen
(Ganzheitliches Lernen)
zu lernen, sind für den Lehrenden von Vorteil,
wenn er nachvollziehen, wenn er nachvollziehen will über welche Ressourcen die Lernenden verfügen, die eine
visuell-ästhetische Präferenz haben. Diese Konzepte sind maßgeblich beeinflusst von der Reformpädagogik.
Daher ist es sinnvoll sich mit den Grundideen dieser Pädagogik zu beschäftigen.
Anschauliches Denken
Die besondere Leistung des gestaltpsychologischen Ansatzes liegt in der Herausarbeitung der Bedeutung des
Anschaulichen (Visuellen) für die Denktätigkeit des Menschen. Es wird davon ausgegangen, dass die Wahrnehmung
eines Reizes mit der Darbietung eines Reizes beginnt und die Leistung darin besteht, den Reiz in einen
Wahrnehmungsinhalt zu transformieren. Die Forschungsrichtung der Gestaltpsychologie betont die aktive
Leistung der Rezipienten. Nach Auffassung von Jacques Lacan
entspricht Wahrnehmung einer Textbildung, sie beinhaltet Artikulation und Reziprozität von Blick und
Angeblicktem.
Auch Rudolf Arnheim
betrachtet die Wahrnehmung von
Formen ebenfalls als einen aktiven Vorgang. Die Wahrnehmung erfasst bevorzugt hervorstechende Merkmale von
Objekten bzw. hervorragende Strukturmerkmale (Arnheim 1980, S. 47). Der normale Gesichtssinn erkennt die
Gestalt ganz unmittelbar. »Er begreift eine Gesamtstruktur« (ebd., S. 56). Dabei ist offensichtlich, dass
die primären Erfahrungswerte Merkmale der Gesamtstruktur sind. Wahrnehmen besteht bei Arnheim (ebd., S. 49)
im Bilden von Wahrnehmungsbegriffen. Das Sehen schafft »Muster aus allgemeinen Formen«, die auf eine
unbestimmte Zahl ähnlicher Fälle anwendbar sind, daher erfüllt der Sehvorgang für ihn die Bedingungen der
Begriffsbildung. »Die Wahrnehmung vollbringt auf der sinnlichen Ebene, was im Bereich des Denkens Verstehen
genannt wird. Im Sehen nimmt jedermann auf bescheidene Art und Weise die zu Recht bewunderte Fähigkeit des
Künstlers vorweg, Muster zu erzeugen, die mittels gestalteter Form eine gültige Interpretation von Erfahrung
liefern. Sehen ist Einsehen« (ebd., S. 50).
Für Arnheim hat nicht nur das Denken, sondern auch die Gesichtswahrnehmung Erkenntnisfunktionen, da sie
bereits wesentlicher Bestandteil der Wahrnehmung selbst ist, wie z.B.:
| Aktives Erforschen | Aussondern | Erfassen des Wesentlichen |
| Vereinfachen | Abstrahieren | Analyse und Synthese |
| Ergänzen | Korrigieren | Vergleichen |
| Kombinieren | Unterscheiden | In Zusammenhang bringen |
| Aufgabe lösen | Kategorisieren | Umformen |
| Wählen | Generalisieren |
Die Wahrnehmung erfasst bevorzugt hervorstechende Merkmale von Objekten bzw. hervorragende Strukturmerkmale.
Der normale Gesichtssinn erkennt die Gestalt ganz unmittelbar, er begreift eine Gesamtstruktur. Dabei ist
offensichtlich, dass die primären Erfahrungswerte Merkmale der Gesamtstruktur sind. Wahrnehmen besteht bei
Rudolf Arnheim aus dem Bilden von Wahrnehmungsbegriffen. Das Sehen schaffe Muster aus allgemeinen Formen,
die auf eine unbestimmte Zahl ähnlicher Fälle anwendbar sind. Aus diesen Gründen erfülle der Sehvorgang die
Bedingungen der Begriffsbildung. »Die Wahrnehmung vollbringt auf der sinnlichen Ebene, was im Bereich des
Denkens Verstehen genannt wird. Im Sehen nimmt jedermann auf bescheidene Art und Weise die zu Recht
bewunderte Fähigkeit des Künstlers vorweg, Muster zu erzeugen, die mittels gestalteter Form eine gültige
Interpretation von Erfahrung liefern. Sehen ist Einsehen« (ebd.).
Unter Erkennen versteht Arnheim alle Tätigkeiten, die beim Empfangen, Bewahren und Verarbeiten von
Tatsachenmaterial im Spiel sind, also die Sinneswahrnehmungen, das Gedächtnis, das Denken und das Lernen.
Auch beim künstlerischen Schaffen sind Wahrnehmung und Denken untrennbar vereint. Er postuliert die Einheit
von Wahrnehmung und Denken. Alles schöpferische Denken in der Philosophie und in der Wissenschaft erfolgt für
ihn in Formen von anschaulichen Bildvorstellungen. Für ihn gibt es keine Denkprozesse, die nicht wenigstens
im Prinzip in der Wahrnehmung anzutreffen sind. Anschauen ist für ihn daher anschauliches Denken.
Linkempfehlungen :
Literatur :
- Arnheim, Rudolf (1969): Anschauliches Denken. Zur Einheit von Bild und Begriff. 4. Aufl., Köln 1980.

Bild-Denken
In unserer Kultur wird das »Bild« nicht mit »Denken« in Verbindung gebracht. Das Denken wird in der
Regel der Kognition zugeordnet. Im Verlaufe unserer Kulturgeschichte haben sich neben den Gestaltpsychologen
vor allem Philosophen mit dem Spannungsverhältnis auseinandergesetzt. Bedeutsame Aussagen, die
William John Thomas Mitchell
zusammen getragen hat, werden hier skizziert.
Das Wort Idee kommt vom griech.: idein = sehen – eidolon = sichtbares Bild. Für die antike Optik und
Wahrnehmungstheorie hatte das sichtbare Bild eine fundamentale Bedeutung (Mitchell 2008, S. 15). Die
platonische Tradition verbindet allerdings mit dem Begriff der Idee keine (sichtbare, natürlich wahrnehmbare)
Bildlichkeit – eidos (übersinnliche Wirklichkeit). Bei Platon ist das eidolon ein Abbild (eikon) oder ein
Anschein (phantasma).
Während für die Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics (Princeton 1974) ein Bild die geistige
Reproduktion einer durch eine physische Wahrnehmung hervorgerufenen Empfindung ist, bedeutet die geistige
Bildlichkeit bei Aristoteles (De anima) ein wesentliches Charakteristikum der Theorie des Geistes (ebd., S.
27).
»Nun müssen wir über die gesamte Sinneswahrnehmung im Allgemeinen sagen, daß [sic]die Sinneswahrnehmung ein
Aufnehmen der wahrnehmbaren Formen ist ohne die Materie, so wie das Wachs das Zeichen des Siegelrings
aufnimmt, ohne das Eisen und das Gold« (424a 16ff – Übersetzung von O. Gigon). »Die Vorstellungskraft ist
für Aristoteles die Kraft, die aufgenommenen Eindrücke auch ohne die Gegenwart des die Sinne stimulierenden
Gegenstandes zu reproduzieren und sie wird mit dem Namen phantasia bezeichnet (von dem das Wort pháos, Licht
abgeleitet), »weil man ohne Licht nicht sehen kann« und das Sehen das vornehmstes Sinnesorgan und Modell
aller anderen ist (429a 2ff.). »Der denkenden Seele«, bemerkt Aristoteles, »sind die Vorstellungsbilder
wie Wahrnehmungseindrücke gegeben […] Darum denkt die Seele niemals ohne ein Vorstellungsbild« (431a 14ff.).
»Das Bewußtsein [sic] selbst wird als Bilder produzierende, reproduzierende und repräsentative Tätigkeit
begriffen, die durch solche Mechanismen wie Linsen, aufnahmefähige Oberflächen und Werkzeuge bestimmt wird,
die dazu geeignet sind, diese Oberflächen zu bedrucken, etwas in sie einzuprägen oder sonst wie Spuren auf
ihnen zu hinterlassen.« (ebd., S. 30)
Es wird nicht behauptet, dass der Geist eine leere Schiefertafel oder ein Spiegel ist, sondern der Geist die
Möglichkeit hat, sich ein Bild von sich selbst zu machen (ebd., S. 33). Es gibt eine Wechselbeziehung
zwischen dem aus materiellen Zeichen bestehenden Bild und der geistigen Tätigkeit. Gedanken sind geistige
Bilder, die sich auf Gegenstände beziehen, weil sie ihnen ähnlich sind.
Ludwig Wittgenstein
formulierte: »Der Satz
ist ein Bild der Wirklichkeit« (Wittgenstein, zit. in: Mitchell, ebd., S. 37). Für ihn ist das Wort ein
geistiges Bild. Das Wort ist ein Bild einer Idee. Eine Idee ist ein Bild eines Dinges – eine
Repräsentationskette – Ideen sind Abbilder unserer Eindrücke. Die Kunst der Sprache bedeutet eine
Wiederbelebung der ursprünglichen Sinneseindrücke.
Er unterscheidet zwischen der materiellen Abbildung oder dem graphischen Bild (niedrige Form der Bildlichkeit)
und einem inneren, organischen, lebendigem Bild (höhere Bildlichkeit). In der Vergeistigung des Bildes sieht
er einen logischen Höhepunkt, eine synchrone Struktur in einem metaphorischen Raum (ebd., S. 44). In der
Moderne erkennt er das Problem, dass dem Bild nur noch als reine Form und Struktur Bedeutung zukommt.
»Die unserer Sprache anscheinend innewohnenden Bilder, ob sie vor dem geistigen Auge entstehen oder auf dem
Papier entworfen werden, sind künstliche, konventionelle Zeichen, genauso wie Sätze, mit denen sie verknüpft
sind« (S. 45).
Zusammenfassend sieht Wittgenstein im Denken sowohl die Tätigkeit des Operierens mit sprachlichen als auch mit
bildlichen Zeichen (ebd., S. 46).
Literatur :
- Mitchell, William John Thomas (2008): Bildtheorie. Suhrkamp, Frankfurt

Ästhetische Erfahrung
Ästhetische Erfahrungen bilden den Kern der ästhetischen Bildung. Sowohl bei der Wahrnehmung ästhetischer
Objekte und Phänomene als auch durch eigene produktive Gestaltung lassen sich ästhetische Erfahrungen machen.
Ästhetische Erfahrungen bedürfen keiner spezifischen Lernumgebung, sie können in der Lebenswelt gemacht werden.
Wichtige Strukturelemente der ästhetischen Erfahrung sind Überraschung und Genuss. Nicht der sinnliche
Wahrnehmungsprozess an sich, sondern die Erfahrung der Diskontinuität und Differenz zu bisher Erlebtem löst
die ästhetische Erfahrung aus. Das Unerwartete sowie überraschende Eindrücke führen mit dem ästhetischen
Reiz zu Korrekturen bisheriger Annahmen von Wirklichkeit. Ästhetische Erfahrung verweist auf die Aktivierung
einer Erfahrung, die Bezug nimmt auf Hypothesen, Fiktionen, Dinge und Ereignisse, die bereits früher
realisiert wurden. Damit verbunden ist die Erschließung neuer Felder, neuer Formen der Erfahrung, die
utopische Korrektur am Bestand bisheriger organisierter Welterfahrungen. Die Erfahrung möglicher
Wirklichkeiten der Wahrnehmung wird ausgeweitet. Dem ästhetischen Lernprozess kommt somit die Funktion zu,
bisherige Welt-Deutungen zu überprüfen, neue Aneignungen von Wirklichkeit zu entwerfen und probehaft
auszuleben.
Kennzeichnend für die ästhetische Erfahrung ist die Vermischung von Kulturaneignung und Kulturproduktion.
Vornehmlich aktualisieren sich ästhetische Erfahrungen in (be-)greifbaren Handlungskontexten (z.B.
Fotorecherche, Filmprojekt, Multimedia, Podcast). Sie stehen im Kontext soziokultureller Aneignungsformen.
Jugendliche machen andere ästhetische Erfahrungen als Erwachsene.
Ästhetische Erfahrung geht über die Nachahmung, die bloße Spiegelung hinaus, sie hat die Kraft des
eigenmächtigen Hervorbringens, der Vergegenwärtigung. Bei der Vergangenheitserkenntnis und bei der
Veränderung der Welt kommt der über Visualisierungen vermittelten, ästhetischen Erfahrung ein Vorrang zu.
Die Produktion von ästhetischer Realität ermöglicht es, die eigentliche Realität klarer und präsenter zu
erfassen. Die Einbildungskraft steht nicht mit dem nach Regeln verfahrenden Verstand (kognitives Denken),
sondern mit der Bewältigung des Lebens (im Bilde sein) in Verbindung.
Ästhetische Ausdrucksformen sind Momentaufnahmen, sie fixieren nicht, sie geben eher Anstöße. Nach jedem
gelungenen ästhetischen Entwurf entsteht das Bedürfnis nach Erweiterung. »Im Reich der Einbildungskraft
gilt, daß [sic] das Sein, sobald ein Ausdruck vorgebracht ist, Bedürfnis nach einem anderen Ausdruck hat,
daß [sic] das Sein alsbald zum Sein eines anderen Ausdrucks werden muß [sic]« (Bachelard 1957, S. 245).
Ästhetische Erfahrung lässt sich als übergreifendes Koordinationssystem bezeichnen, worin alles eingeordnet
wird, worauf alles bezogen wird. Es handelt sich um ein Instrument, mit dessen Hilfe die innere und äußere
Lebenswelt gedeutet, Erfahrungen organisiert, erklärt, überprüft, verarbeitet, gegliedert und geformt werden
(vgl. Hübner 1989, S. 41ff.).
Literatur :
- Bachelard, Gaston (1957/1960): Poetik des Raumes. München.
- Dewey, John (1934): Kunst als Erfahrung Frankfurt a.M. (Suhrkamp) 1980.
- Hübner, Kurt (1989): Aufstieg vom Mythos zum Logos? Eine wissenschaftstheoretische Frage. In: Kemper, Peter (Hg.): Macht des Mythos - Ohnmacht der Vernunft. Frankfurt am Main: Fischer, S. 33-52.
- Röll, Franz Josef (1998): Mythen und Symbole in populären Medien. Der wahrnehmungsorientierte Ansatz in der Medienpädagogik. Frankfurt.